Nearshoring ist auf dem Vormarsch
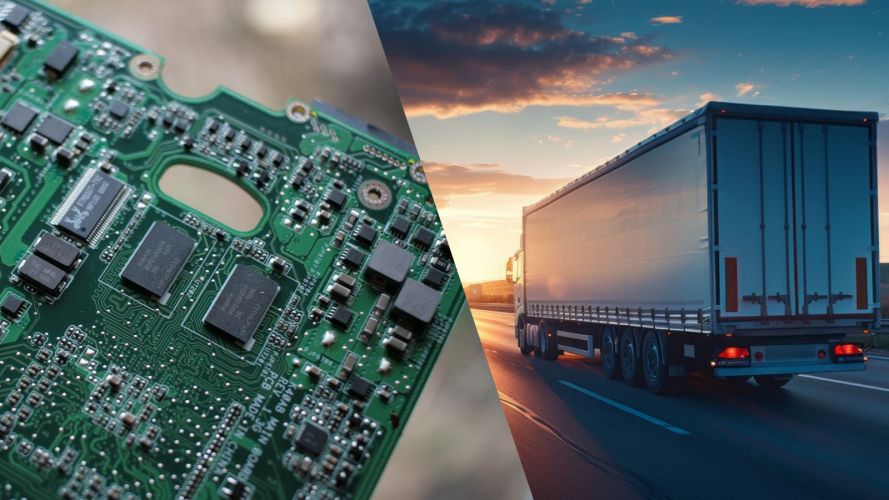
Supply Chains sind anfälliger denn je – in der Folge steigt das Risiko für Lieferverzögerungen und Versorgungsengpässe. Besonders die COVID‑19‑Krise hat die Abhängigkeit Europas etwa im Bereich der Halbleiterproduktion offengelegt. Als Gegenstrategie gewinnt Nearshoring zunehmend an Bedeutung. Fertigung und Services in näher gelegene Länder zu verlagern, verkürzt Lieferzeiten, verbessert die Reaktionsfähigkeit bei kurzfristigen Marktveränderungen und reduziert CO2-Emissionen.
Globale Produktions- und Lieferketten stehen seit einigen Jahren unter Druck. Handelskonflikte, politische Unsicherheiten und krisenbedingte Störungen haben die „Verwundbarkeit“ dieser Strukturen offengelegt. Viele Unternehmen bewerten daher ihre bisherigen Offshoring-Strategien neu und sondieren Alternativen. Eine davon ist Nearshoring, die Verlagerung von Unternehmensaktivitäten wie etwa Fertigungsprozesse oder Dienstleistungen ins nahe Ausland, oftmals in Nachbarländer. Statt maximaler Kosteneffizienz rücken verstärkt Aspekte wie Resilienz, Verfügbarkeit und Reaktionsgeschwindigkeit in den Vordergrund. Kürzere Wege und geringere Abhängigkeiten machen diesen Ansatz besonders für die pharmazeutische Industrie, die Konsumgüterbranche und nicht zuletzt für den europäischen Hochtechnologie-Bereich attraktiv, der während der Pandemie besonders unter der Knappheit von Mikrochips litt.
Schnell wachsende Nachfrage
Die Risiken, die neuerliche Engpässe mit sich bringen würden, steigen deutlich – denn der europäische Bedarf an Chips wächst rasant. Laut einer Erhebung der EU-Kommission aus dem Jahr 2022 dürfte sich die Nachfrage in Europa bis 2030 sogar verdoppeln. Um dem entgegenzuwirken, brachte die EU-Kommission 2023 den European Chips Act auf den Weg, ein Maßnahmenpaket, das 43 Mrd. EUR an öffentlichen und privaten Investitionen mobilisiert. Das Ziel: Die europäische Halbleiterproduktion und Wettbewerbsfähigkeit stärken.
Innerhalb Europas hat sich Sachsen zu einem zentralen Standort der Halbleiterfertigung entwickelt. Den Grundstein legte Robotron bereits im Jahr 1969 in Dresden, heute bildet „Silicon Saxony“ Europas größtes Mikroelektronik- und IKT-Cluster und rangiert im weltweiten Vergleich unter den Top fünf. So beschäftigen rund 3.650 Tech-Unternehmen mehr als 80.000 Menschen. Darüber hinaus stammt schon jetzt jeder dritte in Europa gefertigte Chip aus dem Freistaat – Tendenz steigend. Derzeit entsteht etwa in Dresden eine Fabrik des global führenden Halbleiterherstellers TSMC. Den Produktionsstart an seinem ersten europäischen Standort plant das taiwanische Unternehmen für 2027.
Zunehmend Ansiedlungen aus Asien
Auch bei CTP erleben wir verstärktes Interesse von asiatischen Unternehmen, sich in der EU bzw. in Deutschland anzusiedeln. Dem haben wir durch unsere Standort- und Wachstumsstrategie Rechnung getragen und 2023 unsere erste Niederlassung in Hongkong eröffnet – inzwischen machen Kunden aus Asien etwa 10 Prozent des CTP-Portfolios an Industrie- und Logistikflächen aus. Ein Beispiel für die wachsenden Aktivitäten asiatischer Unternehmen in Europa sind die Investitionen von Topband Smart Europe im rumänischen CTPark Timisoara oder von KSHG Auto Harness im CTPark Deva II.
Und auch der deutsche Markt ist gefragt. Für Quanta Computer Inc. entsteht in Jülich, Nordrhein-Westfalen, ein neuer Hightech-Standort. Für den Hersteller von Computern und elektronischer Hardware, der ebenfalls aus Taiwan stammt, realisieren wir im CTPark Jülich rund 22.500 m² Produktionsfläche, die die Anforderungen des Unternehmens genau abbilden. Zur Ausstattung zählt etwa ein Labor für Produkttests mit speziell konzipiertem Schleusensystem. Auch eine automatisierte Fertigungsstrecke und Robotiklösungen kommen zum Einsatz. Für das Dach sind außerdem großflächige Photovoltaikanlagen geplant sowie eine DGNB-Gold-Zertifizierung. Die Lage in unmittelbarer Nähe zur belgischen und niederländischen Grenze sichert Quanta eine ausgezeichnete logistische Anbindung an weitere europäische Märkte. Insgesamt beläuft sich das Investment auf rund 45 Mio. EUR. Die Fertigstellung des Projekts ist für das zweite Halbjahr 2025 vorgesehen.
Deutsche Standortvorteile
Trotz verschiedener Herausforderungen entscheiden sich Unternehmen wie TSMC oder Quanta, die sich in Deutschland niederlassen, für einen der nach wie vor attraktivsten Wirtschaftsstandorte Europas – nicht zuletzt dank seiner stabilen Rahmenbedingungen und gut ausgebauten Infrastruktur. Neben einem dichten Verkehrs- und Logistiknetz bietet der deutsche Arbeitsmarkt zudem Zugang zu hervorragend ausgebildeten Fachkräften, ein entscheidender Standortvorteil besonders für technologieorientierte Branchen.
Für die erfolgreiche Umsetzung von Nearshoring-Vorhaben braucht es jedoch nicht zuletzt passgenaue Immobilien an verkehrsgünstig gelegenen Standorten. Projektentwickler mit langjähriger Erfahrung und hoher Expertise können diese effizient bereitstellen. Ein langfristig orientierter Bestandshalter ist außerdem in der Lage, auch das Flächenmanagement zu übernehmen, ein Aspekt, der den Markteintritt zusätzlich erleichtert.
Im besten Fall kombinieren Flächenkonzepte die Entstehung neuer Immobilien und Unternehmensstandorte mit der Revitalisierung ungenutzter Brachflächen. Da diese oftmals über eine gut ausgebaute Anbindung und Infrastruktur verfügen, erleichtern sie Unternehmen die Ansiedlung. Darüber hinaus tragen sie dazu bei, den wirtschaftlichen Standort von Kommunen zu stärken – und kommen nicht zuletzt Klima und Umwelt zugute, da keine „grüne Wiese“ versiegelt werden muss.
Autor: Timo Hielscher, Managing Director M&A bei CTP Deutschland